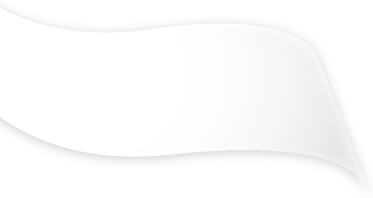Passend zur Faschingszeit hatte der Schwäbische Albverein den renommierten Professor Dr. Werner Mezger vom Institut für Kulturanthropologie und europäische Ethnologie der Universität Freiburg am 1. Februar 2019 in die Stadthalle Plochingen eingeladen. Der begnadete Redner gab vor rund 150 Zuhörern ungewohnte Einblicke in die Ursprungsgeschichte der Fastnacht.
Plochingens Bürgermeister Frank Buß meinte vorab in seinem Grußwort, dass Plochingen und Fastnacht ein Widerspruch in sich sei. „Narretei beschränkt sich aufs Rathaus“, witzelte er.
Fastnacht: ursprünglich nicht lustig
Allerdings ging es beim nachfolgenden Referat eher ernst zu: Prof. Mezger eröffnete seinen Vortrag mit den Worten: „Es gibt an diesem Abend nicht viel zu lachen“.
Mit ungewöhnlichen historischen Informationen und einer Vielzahl beeindruckender Fotos von Bräuchen und bedeutsamen Gemälden nahm er das Publikum mit auf eine mehr als zweistündige Zeitreise. Die komplexe Entwicklung ist im Folgenden zusammengefasst:
Die Zeit vor der Fastenzeit
Zu einfach und nicht richtig sei die Erklärung, es ginge um die Austreibung des Winters. Eine plausiblere sei, die Fastnacht als „die Nacht vor dem Fasten“ einzuordnen – sozusagen ein begriffliches Vorwegnehmen der 40-tägigen Fastenzeit (Aschermittwoch bis Ostern).
Dafür spräche auch das italienische Wort Carnevale was im Prinzip „Wegnahme von Fleisch“ bedeute: Bevor also die Fastenzeit begann, feierte man in der Zeit des Hochmittelalters noch ein orgiastisches Fest.
Kirche nutzt Fastnacht zur Polarisierung
Fasching ist auch eng mit dem Thema Kirche und Glaube korreliert. Mezger sprach von einer nachsichtigen Behandlung der Fastnacht durch die Kirche. Mit der „Civitas diaboli“ hatte die Kirche einen starken Kontrast zum Gottesstaat, der sich in der Fastenzeit manifestierte.
„Der Mensch sollte die Krankheit in der Fastnacht kennenlernen und anschließend während der Fastenzeit ausheilen“, erklärte Mezger dem Auditorium den kirchlichen Gedanken. Auf jede ausgelassene Fastnacht folgt ein Aschermittwoch, auf Völlerei, Begierde und ausgelassenes Feiern die abstinente Fastenzeit. Das war ganz im Sinne der Kirche. Mit dem Verbrennungsritual am Faschingsdienstag ergab sich zudem eine nekrophile Dramaturgie des Ritus.
Die Polarität „Gut und Böse“ war der Institution Kirche prinzipiell willkommen. Sogar zur Tradition der Masken habe die Kirche beigetragen, so Mezger. Einmal pro Jahr bestand die Möglichkeit für das Volk, aus den kirchlichen Requisiten Symbole für das Böse auszuwählen.
Insignien der Gottlosigkeit
Die zum Teil heute noch bei Fastnachtsumzügen genutzten Tonlarven wurden damals zu Teufelssymbolen. Die Figur des Narren folgte später und stand für Gottlosigkeit. Das rührte daher, dass bereits in den lateinischen Psalmen Narrenfiguren mit folgenden Worten auftraten: „Non est deus“. Sie spiegelten damit das Böse in der Welt wider. Spätere Narren-Insignien waren Keule, Schellen, Spiegel und Eselsohren. All das und die auffällige Kleidung, die Schellen, Ohren, Würste usw. sollten die Torheit des Narren verdeutlichen. Besondere Kennzeichen des Narren waren auch Fuchsschwanz und Hahnenkamm. Sie galten als Zeichen für Verschlagenheit bzw. Begierde. Eine gläserne Kugel, eine Schweinsblase oder ein Spiegel standen symbolisch für das Abbild des Narren selbst, ein trügerische und dämonische Fratze.
Der Narr ist der Tod
Narrheit bedeutete nicht an Gott zu glauben, mit der Erbsünde verbunden zu sein, letztendlich mit dem Tod eins zu sein. Der Dreibund aus „Tod, Teufel, Narr“ hat sich somit seinen Ausdruck in den Masken und Symbolen der Fastnacht verschafft. Viele Kostüme und Masken kann man auch heute noch auf Fastnachts-Umzügen bewundern. Sie weisen laut Mezger eine hochkomplexe Bedeutungsgeschichte auf.
Er sieht in den Fastnachtsbräuchen ein wichtiges kulturelles Kapital innerhalb Europas, das nicht zuletzt deshalb auch als immaterielles Kulturerbe der Menschheit auf der Liste der UNESCO steht.