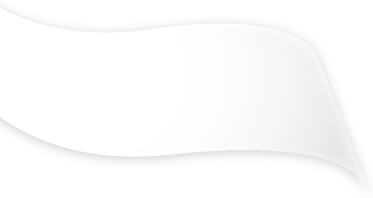Achtsames Wandern, Kräutertouren und Kartenlesen für Frauen – Schwäbischer Albverein stellt zum Weltfrauentag sein diesjähriges FrauenSpecial vor
Stuttgart. Der Schwäbische Albverein stellt zum Internationalen Frauentag am 8. März sein diesjähriges FrauenSpecial vor. Unter dem Motto „Frauen naturverliebt“ bietet der Wanderverein 2020 zehn Wanderungen, Ausflüge und Seminare exklusiv für die weibliche Zielgruppe an. „Wir haben festgestellt, dass Frauen manchmal einfach gerne unter sich sein wollen – auch beim Wandern“, erklärt Karin Kunz, Wanderreferentin beim Albverein und Geschäftsführerin der Heimat- und Wanderakademie.
Frauen interessierten sich oft für die Kleinigkeiten am Wegesrand wie Blumen oder Schmetterlinge und seien häufig weniger an Leistung interessiert, berichtet Karin Kunz. Deshalb werde bei den Frauenwanderungen viel Wert auf Achtsamkeit in der freien Natur gelegt. Dazu kämen häufig meditative Elemente. Außerdem bietet der Albverein Wanderungen an, bei denen Geschichten und Schicksale von Landfrauen auf der Alb im Mittelpunkt stehen. Beliebt sind zudem Touren, bei denen Kräuter gesammelt und anschließend zu leckeren kleinen Happen verarbeitet werden, berichtet Kunz.
„Bei der Ausbildung an Karte und Kompass haben wir zudem festgestellt, dass Frauen einen anderen Zugang zu Orientierung und topografischen Karten haben als Männer“, erklärt Karin Kunz. Deshalb habe man das Seminar „Allein in der Pampa – Karten lesen für Anfängerinnen“ mit ins Programm genommen.
Weitere Informationen: https://wandern.albverein.net/frauenspecial
Programm „Frauen naturverliebt 2020“
Samstag, 14. März
Wandern und Entspannen in Kohlberg
Meditieren in der Natur + einfache, leichte Entspannungsübungen = „Lebensfreude durch Gesundheitstour“ für jedes Alter
Freitag, 20. März
Zeit des Aufbruchs, Veringenstadt
Frühling und Frühlingskräuter = Lebenskraft und Lebensfreude
Am offenen Feuer wird erzählt, getanzt, gesungen, gegrillt und gevespert
Samstag, 28. März
Magie und Kraft der Frühlingskräuter, Wendlingen
Traditionelles Wissen mit modernen Erkenntnissen verknüpfen, Tipps wie man mit den Pflanzen umgeht. Kostproben aus „wilden“ Zutaten
Sonntag, 10. Mai
Auf Tour am Muttertag, Wendlingen
Auf den Spuren von Mörike dem Alltag entfliehen und die Natur mit vollen Sinnen spüren und genießen
Donnerstag, 28. Mai
Auf Frauenspuren im Freilichtmuseum Beuren
Einblick in die oft vergessene Geschichte von ganz alltäglichen Frauenschicksalen auf dem Land
Samstag, 15. August
Führung „Von wegen Hausmütterchen“, Lenningen-Gutenberg
Starke Frauen am Albtrauf. Eintauchen in die lokale und regionale Frauengeschichte
Donnerstag, 1. Oktober
„Nichts Schöneres unter der Sonne…“, Beuren
Herbstsonne, Herbstfrüchte, Herbstfarben mit allen Sinnen erleben mit Verkostung aus der Streuobstwiese
Samstag, 10. Oktober
Wandern und Entspannen, Beuren
Meditieren in der Natur + einfache, leichte Entspannungsübungen = „Lebensfreude durch Gesundheitstour“ für jedes Alter
Freitag, 23. Oktober
Was Bäume erzählen, Filderstadt
Bäume als Lebensspender, Lebensraum, Freund – nicht erst seit Peter Wohlleben kann man viel von Bäumen lernen